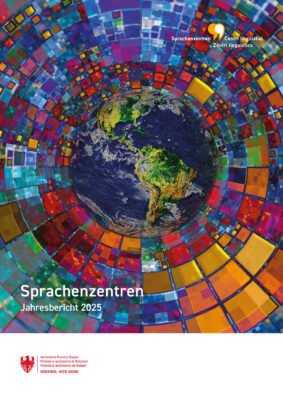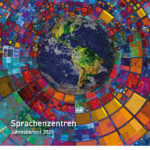Interview mit Tristan Horx
„Kinder haben ein Recht auf eine analoge Kindheit“

Wenn Roboter bessere Roboter werden, müssen wir Menschen humaner werden, sagt Zukunftsforscher Tristan Horx. Im Interview spricht er über übertriebene Ängste vor KI, das Ende alter Gewissheiten und die Rolle von Schule in einer Zeit, in der nicht mehr Wissensvermittlung, sondern Menschlichkeit, Empathie und Konfliktfähigkeit im Vordergrund stehen müssen.
Tristan Horx ist einer der bekanntesten Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Er hält international Vorträge und schreibt über gesellschaftliche, technologische und kulturelle Veränderungen. Für die Eröffnungskonferenz der Deutschen Bildungsdirektion zum Schuljahr 2025/2026 hielt er am 24. September 2025 einen digitalen Vortrag mit dem Titel „Die Zukunft war schon mal klarer“. INFO hat vorab mit ihm über seine Thesen gesprochen – über apokalyptische Szenarien, über Chancen und Grenzen der Künstlichen Intelligenz und über die Frage, wie Schule heute auf die Zukunft vorbereiten sollte.
INFO: Ihr Vortrag für die Eröffnung des Bildungsjahress 2025/26 trägt den Titel „Die Zukunft war schon mal klarer“. Was meinen Sie damit?
Tristan Horx: Wir haben als Zukunftsforscher lange mit den sogenannten Megatrends gearbeitet. Globalisierung, Individualisierung, Digitalisierung – all das waren relativ verlässliche Konstanten. Sie zeigten klar an, wohin die Welt unterwegs ist. Aber jeder Trend ruft auch einen Gegentrend hervor. Heute sehen wir: Globalisierung stagniert, teils läuft sie sogar rückwärts. Die Verheißung einer immer gesünderen und längeren Lebensspanne flacht ab. Und die Individualisierung? Gerade jetzt wächst politisch wieder das Bedürfnis nach dem Kollektiv, nationalistischen Parteien gelingt damit massiver Zulauf. Kurz gesagt: Die Formeln, mit denen die Nachkriegsgeneration Zukunft noch ziemlich linear vorhersagen konnte, funktionieren so nicht mehr.
Viele Menschen empfinden technologische Entwicklungen wie KI als bedrohlich. Was davon ist ernst zu nehmen – und was übertrieben?
Zunächst: Gelassenheit! (lacht) Wir haben gerade eine Neigung, jede neue Technologie in Extremen zu denken. Bei Blockchain hieß es: Sie revolutioniert alles. Beim Metaverse: Wir leben bald alle nur mehr virtuell. NFTs sollten die Kunstwelt für immer verändern. Und jetzt ist KI „die“ Technologie, die uns entweder rettet oder vernichtet. Das ist eine Überhöhung in beide Richtungen. Natürlich wird KI viel verändern. Aber sie ist ein Werkzeug wie jedes andere – mit Vorteilen, Nachteilen und einer gewissen Zeit des Übertreibens. Danach kommt die Korrektur. Beim Internet haben wir das gesehen: Erst Euphorie, dann Probleme – und jetzt Regulierung und Kulturtechniken. Dasselbe passiert mit KI.
Vielleicht arbeiten wir in Zukunft vier Stunden pro Tag und produzieren trotzdem denselben Output. Klingt doch nicht schlecht, oder?
Sie sprechen von apokalyptischen Szenarien, die so nie eintreten werden. Welche meinen Sie?
Das klassische Terminator-Szenario: Roboter entwickeln Eigenbewusstsein, übernehmen die Macht und löschen die Menschheit aus. Das ist Science-Fiction. Historisch gesehen war die Wahrscheinlichkeit eines Atomkriegs im Kalten Krieg ungleich höher. Realistischer – und spürbarer – ist die Angst vor Jobverlust. Ja, KI und Automatisierung werden Arbeitsfelder verändern. Aber gerade in überalterten Gesellschaften wie Deutschland, Österreich oder Italien sollten wir uns wünschen, dass Maschinen Arbeit übernehmen – in Pflege, Gesundheit oder Landwirtschaft. Das entlastet, wo sonst schlicht das Personal fehlt.
Automatisierung als Chance?
Genau. Wir bewegen uns vom fossil geprägten Industriezeitalter ins digitale Zeitalter. Das bedeutet: Routinen, die uns nerven, werden Maschinen übernehmen. Vielleicht arbeiten wir in Zukunft vier Stunden pro Tag und produzieren trotzdem denselben Output. Klingt doch nicht schlecht, oder? Das Problem ist: Wir hängen mental noch im Acht-Stunden-Dogma des Industriezeitalters fest. Wer weniger arbeitet, fühlt sich schnell schuldig. Diese kulturelle Fixierung muss sich lösen.
Was bedeutet das für die Schule?
KI hält der Schule einen Spiegel vor. Lange Zeit war die Hauptleistung von Bildung: Wissensvermittlung. Die Lehrperson war der Speicher, die Schülerinnen und Schüler holten sich die Information ab. Diese Rolle ist passé – Wissen ist heute überall abrufbar. Schule muss sich deshalb auf etwas anderes konzentrieren: auf die Vorbereitung auf Gesellschaft. Empathie, Kommunikationsfähigkeit, Umgang mit Konflikten, Verantwortungsbewusstsein – das sind die Kompetenzen, die künftig zählen.
In einer Kurzbeschreibung zu ihrem Vortrag steht: „Wenn Roboter bessere Roboter werden, müssen wir humanere Menschen werden.“ Was heißt das konkret?
Weniger Frontalunterricht, mehr Interaktion. Mehr Fokus auf die weichen Fähigkeiten – die in Wahrheit harte Überlebenskompetenzen sind. Soft Skills, die man früher belächelt hat, werden zum Wettbewerbsvorteil. KI kann repetitives Wissenstraining übernehmen. Aber Menschlichkeit, Kreativität, Konfliktfähigkeit – das kann keine Maschine.
Nur weil Digitales möglich ist, ist es nicht automatisch besser.
Derzeit läuft die Debatte: Digitales Lernen versus Stift und Papier. Wie sehen Sie dieses Spannungsfeld?
Neurowissenschaftlich ist klar: Handschrift verankert Wissen besser. Unser Gehirn speichert Informationen, die wir räumlich verorten, nachhaltiger ab. Das stammt noch aus Zeiten, in denen wir uns im Gelände orientieren mussten. Das bedeutet, dass Papier einen großen Wert hat. Gleichzeitig sollten wir das Digitale nutzen, wo es Sinn macht – etwa bei Verwaltung, Logistik, individueller Förderung. Aber: Nur weil Digitales möglich ist, ist es nicht automatisch besser. Skandinavien ist da spannend: Man hat stark auf iPads gesetzt – und fährt gerade zurück, weil man merkt, dass analoges Lernen unersetzlich ist.
Was glauben Sie, wie verändert KI die Rolle der Lehrperson? Werden Lehrerinnen und Lehrer künftig eher Coaches, Mentorinnen und Mentoren oder Moderatorinnen und Moderatoren?
Diese Vorstellung halte ich für eine lineare Fehlprognose. Die Idee, dass Lehrkräfte in Zukunft nur noch dazu da sind, Schülerinnen und Schülern zu zeigen, wie man KI richtig einsetzt, greift viel zu kurz. Meine These ist: Große Teile des Unterrichts werden sich stärker auf das Humane fokussieren. KI kann Schülerinnen und Schülern helfen, ihre eigenen Lernziele zu managen, Informationen zu personalisieren – je nach Lerntyp, auditiv, visuell und so weiter. Lehrkräfte werden dafür Tools zur Verfügung haben. Aber die Vorstellung, sie könnten durch Roboter ersetzt werden, ist eine Illusion. Das wird der Aufgabe von Bildung, zumindest in der Schule, nicht gerecht.
Aber viele Lehrkräfte sind technisch noch kaum vorbereitet. Sie tun sich schon jetzt schwer mit PCs oder Tablets. Können sie das überhaupt leisten?
Genau deshalb braucht es neue Strukturen. Ich würde empfehlen, innerhalb der Schulen eigene Einheiten oder Organisationen aufzubauen, die sich ausschließlich mit digitalen Tools beschäftigen. Sonst laufen wir der Entwicklung hinterher – und die jüngeren Digital Natives tanzen den Lehrkräften einfach davon. Lehrpersonen sollten sich auf das konzentrieren, was sie wirklich gut können: pädagogische Arbeit, Begleitung, das Humane. Für das Digitale braucht es zusätzliches, spezialisiertes Know-how. Natürlich kommen laufend junge Lehrkräfte ins System, die technischer fit sind. Aber zu erwarten, dass man allen – vor allem älteren – Lehrpersonen die gesamte digitale Kompetenz noch beibringt, ist ineffizient.
Unser Schulsystem produziert noch immer zu sehr „Einheitsmenschen“. Die Zukunft verlangt Vielfalt.
Das bedeutet aber auch, dass sich die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung deutlich verändern muss?
Absolut. Schon heute ist das Verhältnis falsch: In Österreich zum Beispiel besteht die Ausbildung zu fünf Sechsteln aus Fachwissen und nur zu einem Sechstel aus Pädagogik. Das müsste man eigentlich umdrehen – und zusätzlich noch digitale und hybride Kompetenzen verankern. Wichtig ist: Analog und digital sind keine Gegner. Manche Dinge machen analog großen Sinn, andere digital. Lehrpersonen müssen lernen, das zu unterscheiden. Stattdessen sehen viele Lehrkräfte das Digitale als Bedrohung ihres Berufsstandes. Das ist es nicht. Aber bevor man versucht, 50-Jährigen das alles noch beizubringen, sollte man überlegen, ob nicht unterschiedliche Ausbildungswege sinnvoll sind. Manche bleiben stärker im Analogen, andere im Digitalen – und beides ist legitim.
KI entwickelt sich in rasantem Tempo. Wie können Bildungssysteme, die oft träge wirken, damit Schritt halten?
Müssen sie gar nicht. Es ist ein Fehler zu glauben, man könne mit Silicon Valley mithalten. Das wird schlicht nicht passieren. Wer diesen Anspruch hat, läuft permanent in eine Versagerrolle und bekommt am Ende nur den Spott: „Schaut her, wir arbeiten noch mit Papier und Stift.“ Diesen Druck sollte man rausnehmen. Stattdessen braucht es Institutionen oder Schnittstellen, die technologische Entwicklungen übersetzen und an die Schulen herantragen. Und man darf ruhig auch von anderen lernen: Skandinavische Länder sind bei der Digitalisierung der Schulen weit vorausgegangen – und ziehen nun manches zurück, weil sie gemerkt haben, dass analoges Lernen unverzichtbar bleibt. Das zeigt: Man muss nicht immer der Erste sein. Viel wichtiger ist es, die Balance zu finden und den Dogmatismus zu vermeiden. Die Idee, dass am Ende alles digitalisiert werden muss, ist schlicht falsch.
Welche Kompetenzen braucht es, um Kinder auf eine KI-Welt vorzubereiten?
Erstens: ein Recht auf eine analoge Kindheit. Kinder müssen offline Erfahrungen machen, Langeweile spüren, Selbstwirksamkeit erfahren. Zweitens: Förderung individueller Talente. Unser Schulsystem produziert noch immer zu sehr „Einheitsmenschen“. Die Zukunft verlangt Vielfalt. In den USA kann ein Kind, das nicht gut in Mathe ist, aber künstlerisch begabt, einen komplett angepassten Lehrplan bekommen. Davon sind wir weit entfernt.
Für die ersten Jahre würde ich mir eine Schule wünschen, die Digitalität stark begrenzt. Analoge Kindheit, Spiel, Begegnung, Langeweile inklusive.
Sie sprechen viel von Generationen. Wo prallen hier die größten Missverständnisse aufeinander?
Jede Generation hält die nächste für faul. Das ist ein Muster, das man bis Sokrates zurückverfolgen kann. Heute kommt dazu: Wir überschätzen Jugendlichkeit und Digitalität – und unterschätzen Erfahrung und Weisheit. Wer über 50 ist und einen neuen Job sucht, gilt oft als Auslaufmodell. Aber eigentlich sollten wir junges, digitales Wissen und alte Erfahrung kombinieren. Das wäre zukunftsweisend.
Zum Abschluss: Wie sieht Ihre Schule der Zukunft aus?
Ich denke oft darüber nach – auch, weil ich selbst irgendwann Kinder haben werde. Für die ersten Jahre würde ich mir eine Schule wünschen, die Digitalität stark begrenzt. Analoge Kindheit, Spiel, Begegnung, Langeweile inklusive. Ab der Jugend braucht es dann digitale Schnittstellen, die wirklich auf die Berufswelt vorbereiten. Vielleicht sogar eine Aufspaltung: Wer in soziale, menschliche Berufe will, geht den einen Weg. Wer in die Tech-Welt will, den anderen. Und vor allem: Die Zukunft entsteht nicht, indem man Altes wegwirft. Sie entsteht, wenn man das Gute von früher mit dem Sinnvollen von heute verbindet.