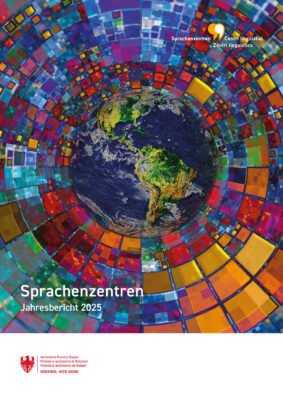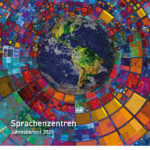Interview mit Michaela Sburny
Führen ohne Macht

Die Organisationsberaterin Michaela Sburny begleitet seit Jahren Schuldirektorinnen und Schuldirektoren sowie solche, die es werden wollen. In Schloss Rechtenthal in Tramin leitet sie ein Fortbildungsmodul zu Personalführung und -entwicklung – über Motivation, Rollenbilder und die Kunst des Führens ohne Macht.
Wie führt man Menschen, die man nicht führen kann – oder darf? Diese Frage steht im Zentrum des zweitägigen Fortbildungsmoduls, das Michaela Sburny an diesem Donnerstag und Freitag (9. und 10. Oktober 2025) im Schloss Rechtenthal für angehende Schulführungskräfte in Südtirol leitet. Das Thema: Personalführung und -entwicklung.
Sburny, Organisationsberaterin, frühere Lehrerin und ehemalige Bundesgeschäftsführerin der österreichischen Grünen, arbeitet seit vielen Jahren mit Schulen und anderen sogenannten „Expertinnen- und Expertenorganisationen“. Sie weiß, wie anspruchsvoll Führung dort ist, wo es wenig Entscheidungsspielraum, aber viele Erwartungen gibt.
Im Gespräch mit INFO erklärt sie, warum Schulen anders funktionieren als Unternehmen, welche Haltung erfolgreiche Führungskräfte brauchen – und warum Zynismus in der Schule gefährlicher ist als Fehler.
INFO: Frau Sburny, worum geht es in Ihrem Fortbildungsmodul zur Personalführung und -entwicklung im Kern?
Michaela Sburny: Es geht um angehende Schulführungskräfte, die lernen wollen, wie man in einem so komplexen System wie der Schule Personal führt und entwickelt. Die meisten Teilnehmenden sind noch keine Direktorinnen und Direktoren, einige führen aber bereits kleine Schulen. Wir beschäftigen uns also mit der Frage, was Personalführung bedeutet, wenn man nur über geringe formale Macht verfügt – aber trotzdem Verantwortung trägt.
Welche Dynamiken erleben Sie derzeit besonders stark im System Schule?
Ganz deutlich spürbar ist der Lehrermangel. Er führt zu enormer Belastung bei Lehr personen und Schulleitungen, weil ständig improvisiert werden muss. In Österreich zeichnet sich heuer erstmals eine leichte Entspannung ab, aber die Situation bleibt schwierig. Gleichzeitig steigen die Anforderungen: gesellschaftlich, sprachlich, pädagogisch. Viele Schülerinnen und Schüler sprechen zu Hause kein Deutsch – das stellt Schulen vor enorme Integrationsaufgaben.
Zugleich ist die Schule ein System mit sehr begrenzten Entscheidungsspielräumen. Schulführungskräfte haben wenig Einfluss darauf, wer an ihre Schule kommt, müssen aber Qualität sichern und Motivation aufrechterhalten. Dieses Spannungsfeld zwischen Person und Organisation ist die eigentliche Herausforderung.
Schule führen heißt: stets im Dialog bleiben.
Was bedeutet dieses Spannungsfeld konkret für eine Schulleitung im Alltag?
Führen in der Schule funktioniert nicht top-down. Man ist auf die Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen angewiesen. Es braucht klare Ziele, aber auch Freiheit bei der Umsetzung. Gute Führung schafft Orientierung und lässt Gestaltungsspielraum. Das kann heißen, in pädagogischen Konferenzen gemeinsame Ziele zu formulieren, Reflexionsrunden einzuführen oder regelmäßige Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitergespräche zu führen. Wichtig ist, dass alle verstehen, wohin die Schule will – und dass sie sich einbringen können. Schule führen heißt: stets im Dialog bleiben.
Auf eine Schulleitung prallen viele Erwartungen – von Lehrpersonen, Eltern, Gesellschaft und Politik. Wie kann man damit umgehen, ohne sich zu überfordern?
Genau das thematisieren wir in der Fortbildung. Führungskräfte müssen ihre Anspruchsgruppen kennen und priorisieren: Was sind berechtigte Erwartungen, was ist überzogen, was widerspricht unseren Zielen? Es geht um Kommunikation – klar, respektvoll, aber auch mit Grenzen.
Eine gute Schulleitung schützt ihr Kollegium vor übermäßigen Ansprüchen von außen, muss aber auch klar benennen, wo Veränderung nötig ist. Das erfordert ständige Selbstreflexion und Selbstführung: Wo stehe ich, wo ist mein Team, was braucht es jetzt?
Ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist „Positive Leadership“ und „motivorientiertes Führen“. Wie lässt sich das in der Praxis umsetzen?
Positive Leadership beginnt mit Haltung. Ich muss meine Kolleginnen und Kollegen als Expertinnen und Experten sehen und nicht als Ausführende. Die systemische Beraterin für Führung und Change Management Ruth Seliger beschreibt das sehr schön: Menschen brauchen Sinn, Zuversicht und Handlungsspielraum.
Wenn Lehrpersonen wissen, warum etwas wichtig ist, spüren, dass sie es können, und Freiheit haben, ihren Weg zu finden, entsteht Motivation. Das lässt sich üben – etwa durch kurze, strukturierte Gespräche oder gezielte Besprechungen. Es geht immer darum, Sinn zu vermitteln und Vertrauen zu schaffen.
Was braucht es, damit sich Lehrpersonen langfristig mit ihrer Schule identifizieren und engagiert bleiben?
Sinn ist zentral – aber der Sinn ist für jede Person unterschiedlich. Manche arbeiten, weil sie Freude an Kindern und Jugendlichen haben, andere wegen der Stabilität oder des Teams. Führung heißt, diese individuellen Motive zu kennen und ernst zu nehmen.
Es gibt ein Modell, das 16 Lebensmotive unterscheidet. Wenn ich merke, jemand ist unzufrieden, kann ich im Gespräch herausfinden, was fehlt. Gleichzeitig müssen Lehrkräfte selbst Verantwortung übernehmen. Manchmal lautet das Ergebnis auch: Ich bin hier nicht mehr am richtigen Ort. Das ehrlich zu erkennen, ist oft der erste Schritt zur Veränderung.
Teams müssen sich entwickeln dürfen – das dauert. Wichtig ist, dass Kommunikation, Vertrauen und Transparenz wachsen können.
Wie sehr prägt die Schulkultur das Miteinander – und wie kann eine Leitung sie gestalten?
Ohne Führungskraft keine Kulturveränderung – das ist ganz klar. Kultur ist das, was Menschen tun, ohne dass es jemand anordnet. Wenn ich neu an eine Schule komme, muss ich zuerst verstehen, welche Kultur dort herrscht.
Ein Beispiel: In manchen Schulen dominieren informell die Sportlerinnen und Sportler. Wenn die Schulleitung dann ein Sportfest vorschlägt, reagieren alle ablehnend – weil das in der Kultur eigentlich das Terrain der Sportgruppe ist. Wer das nicht versteht, scheitert schnell mit guten Ideen.
Schulkultur zu gestalten heißt, Muster zu erkennen, Hypothesen zu bilden und gezielte Interventionen zu setzen – kleine Schritte, die etwas in Bewegung bringen.
Was macht ein funktionierendes Team in der Schule aus?
Ein Team braucht ein gemeinsames Ziel und einen klaren Auftrag. Sonst ist es einfach eine Gruppe. Viele „Teams“ an Schulen sind in Wahrheit keine.
Führung heißt, Rahmenbedingungen zu schaffen, klare Zeitfenster und Reflexionsphasen einzubauen und Zuständigkeiten zu klären. In der Anfangsphase braucht es oft starke Leitung, später kann sie sich zurücknehmen. Teams müssen sich entwickeln dürfen – das dauert. Wichtig ist, dass Kommunikation, Vertrauen und Transparenz wachsen können.
Was sind die häufigsten Stolpersteine bei Schulführungskräften – und was gelingt besonders gut?
Besonders erfolgreich sind jene, die klare Organisationsziele formulieren und gleichzeitig zeigen, dass ihnen das Wohl der Kolleginnen und Kollegen wichtig ist. Wo Führung transparent und dialogisch geschieht, ist das Schulklima meist hervorragend.
Stolpersteine sind Zynismus und Hilflosigkeit. Viele Schulleitungen fühlen sich ohnmächtig – zu wenig Ressourcen, zu viele Erwartungen. Manche ziehen sich dann zurück oder werden sarkastisch. Aber genau das zerstört Motivation. Gute Führung heißt, auch mit dieser Ohnmacht konstruktiv umzugehen.