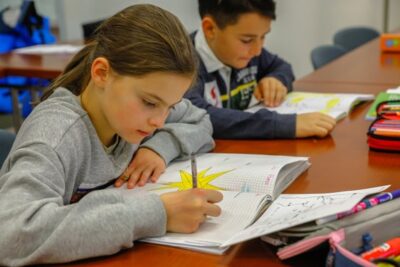Interview zur inklusiven Begabungsförderung
„Schülerinnen und Schüler ans Steuer lassen“

Die Erziehungswissenschaftlerin Gabriele Weigand plädiert für eine Schule, die jedes Kind als Person in den Blick nimmt – jenseits von Etiketten wie „schwach“ oder „hochbegabt“. In Brixen leitete sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden Mirjam Maier-Röseler und Katharina Weiand eine Fortbildung zur inklusiven Begabungsförderung. Im Interview erklärt sie, wie Kinder ihre Fähigkeiten entfalten können, welche Kultur Schulleitungen stiften sollten und warum gute Förderung immer auf Beobachtung und Vertrauen basiert.
Mit der zweitägigen Fortbildung „Vielfalt (an)erkennen, Potenziale entfalten: Person-Orientierung zur inklusiven Begabungsförderung“ haben Gabriele Weigand und ihr Team am 21. und 22. Oktober 2025 in Brixen Lehrpersonen, pädagogische Fachkräfte und Schulleitungen zusammengebracht, um Schule neu zu denken: weg von Defiziten, hin zu einer Pädagogik, die jedes Kind in seiner Einzigartigkeit wahrnimmt. Im Gespräch mit INFO spricht die Professorin der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe über die Idee einer personorientierten Schule, die Stärken und Potenziale aller Lernenden sichtbar macht – und damit auch Lehrpersonen selbst in den Blick nimmt. Als wissenschaftliche Leitung koordiniert sie in Deutschland dazu die bundesweite Initiative „Leistung macht Schule“, an der mittlerweile 850 Schulen teilnehmen.
INFO: Frau Weigand, Sie sprechen von „Personorientierung“ als Leitidee einer inklusiven Begabungsförderung. Was bedeutet das genau?
Gabriele Weigand: Personorientierung heißt, jedes Kind als Person ernst zu nehmen, anzuerkennen, wertzuschätzen und in seiner Einzigartigkeit zu fördern. Der Personenbegriff geht dabei weit über das Alltagsverständnis hinaus. Er beschreibt nicht einfach Individuen, sondern Menschen in ihren Beziehungen – zu sich selbst, zu anderen, zur Gesellschaft, zur Welt. Wer Schule personorientiert denkt, sieht die Kinder nicht als Teil eines Systems, sondern als Subjekte ihres eigenen Lernens. Ziel ist es, dass jeder Mensch Autor oder Autorin des eigenen Lebens wird – urteilsfähig, selbstbestimmt, verantwortungsbewusst.
Das klingt nach einem sehr umfassenden Anspruch. Wie lässt sich das in der Schule konkret umsetzen?
Indem wir Lernumgebungen schaffen, die Kinder dazu befähigen, autonome Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Unterricht sollte nicht nur Standards und Strukturen folgen, sondern Räume öffnen, in denen Kreativität, Selbstwirksamkeit und Innovation entstehen können. Es geht darum, die Schülerinnen und Schüler aktiv einzubeziehen, sie nicht auf der „Rückbank des Autos“ durch die Bildungsinstitutionen zu fahren, sondern sie ans Steuer zu lassen.
In einer weiten, personorientierten Sichtweise bedeutet Inklusion aber, dass jedes Kind – unabhängig von seinen Voraussetzungen, seiner Herkunft und seinem Geschlecht – das bestmögliche Lernumfeld bekommt.
Oft werden Inklusion und Begabungsförderung als Gegensätze verstanden – hier die Schwächeren, dort die Starken. Sie nennen das ein Missverständnis. Warum?
Weil Inklusion im eigentlichen Sinn alle meint. Leider wurde der Begriff im deutschen Sprachraum lange mit „sonderpädagogischem Förderbedarf“ gleichgesetzt. In einer weiten, personorientierten Sichtweise bedeutet Inklusion aber, dass jedes Kind – unabhängig von seinen Voraussetzungen, seiner Herkunft und seinem Geschlecht – das bestmögliche Lernumfeld bekommt. Das Ziel ist nicht Gleichmacherei, sondern individuelle Förderung. Jedes Kind soll die Möglichkeit haben, seine Potenziale zu entdecken und in Kompetenzen und Performanz umzusetzen.
Sie betonen in Ihrer Arbeit die Verbindung zwischen Potenzial, Kompetenz und Performanz. Was genau ist damit gemeint?
Potenziale sind Anlagen oder Möglichkeiten, die in jedem Menschen vorhanden sind – oft unsichtbar, manchmal noch unentwickelt. Kompetenzen sind das, was wir daraus machen: Wissen, Können, Haltung. Performanz schließlich ist das, was sichtbar wird, wenn Potenziale in Handlung übergehen. Schule sollte alle drei Ebenen im Blick behalten: Potenziale entdecken, Kompetenzen aufbauen und Räume schaffen, in denen Kinder ihre Fähigkeiten zeigen können. Lernen ist dabei kein linearer Prozess, sondern ein Kreislauf – Potenziale werden sichtbar, führen zu Kompetenzen und sichtbaren Leistungen, die wiederum neue Potenziale freisetzen.
Wie kann Schule Bildungsbiografien stärker berücksichtigen?
Indem sie die Herkunft eines Kindes ernst nimmt, ohne es auf diese festzuschreiben. Jedes Kind bringt seine eigene Geschichte, seine Erfahrungen und seine Möglichkeiten mit. Aufgabe der Schule ist es, daran anzuknüpfen – nicht zu stigmatisieren, sondern zu ermutigen. Das bedeutet auch, dass Lehrpersonen Kindern etwas zutrauen, sie fordern und zugleich begleiten. Es geht um ein Gleichgewicht zwischen Vertrauen, Herausforderung und Unterstützung.
Begabungsförderung heißt also auch Begleitung. Welche Haltung braucht eine Lehrperson, um Kinder wirklich zu begleiten – und nicht nur zu beurteilen?
Eine Haltung des echten Interesses. Lehrpersonen sollten nicht nur Wissensvermittlerinnen sein, sondern Mentorinnen, die Kinder in ihrer ganzen Persönlichkeit wahrnehmen. Das bedeutet, auf Augenhöhe zu kommunizieren, zuzuhören, Vertrauen aufzubauen. Gute Beratung geschieht nicht in einer formalen Rolle, sondern von Mensch zu Mensch. Mentoring ist, wenn man so will, die Königsdisziplin der Begabungsförderung – weil es Persönlichkeitsentwicklung ermöglicht und Kinder befähigt, sich selbst besser zu verstehen und weiterzuentwickeln.
Wenn Kinder erleben, dass sie als Person gesehen werden, steigt ihre Motivation. Und wenn Lehrpersonen in einem unterstützenden Kollegium arbeiten, entsteht eine gesunde, lebendige Schule.
Und wie kann eine Schule als Institution diese Haltung verankern?
Mit einer gemeinsamen Vision. Ich spreche gerne von einem pädagogischen Konsens innerhalb der Schulgemeinschaft: Lehrpersonen, Schulleitung, Eltern und Kinder teilen die Grundidee, dass Schule ein Ort der Wertschätzung und Potenzialentfaltung ist. Das verändert vieles – vom Unterricht bis zur Teamkultur. Wenn Kinder erleben, dass sie als Person gesehen werden, steigt ihre Motivation. Und wenn Lehrpersonen in einem unterstützenden Kollegium arbeiten, entsteht eine gesunde, lebendige Schule.
Das setzt voraus, dass auch Schulleitungen diese Kultur mittragen. Welche Rolle kommt ihnen zu?
Eine entscheidende. Schulleitung heißt nicht Kontrolle, sondern Ermöglichung. Eine gute Schulleitung lebt vor, was sie von anderen erwartet: Sie handelt transparent, teilt Verantwortung und schafft Vertrauen. Leadership bedeutet, Verantwortung auf viele Schultern zu verteilen, Prozesse zu initiieren und die Menschen im System zu stärken. Nur wenn Schulleitungen selbst personorientiert führen, kann eine Schule personorientiert handeln.
Zwischen Theorie und Praxis klafft aber oft eine Lücke. Wo sehen Sie aktuell die größten Hürden?
Viele Hindernisse liegen im Denken. Lehrpersonen sagen häufig: „Wir fördern doch alle Kinder.“ Doch in der Praxis orientieren sich viele noch am Durchschnitt – die Starken bekommen Zusatzaufgaben, die Schwachen Unterstützung. Das führt wieder zu einer Dreiteilung. Die Herausforderung ist, Potenzialorientierung wirklich für alle Kinder zu denken. Empirisch wissen wir: Klassische Begabtenprogramme begünstigen meist ohnehin privilegierte Kinder. Inklusive Begabungsförderung dagegen öffnet Perspektiven für alle. Es geht nicht um Sonderprogramme, sondern um eine Haltung – eine Stärkenorientierung, die Unterricht und Miteinander verändert.
Studien zeigen: Schulen, die personorientiert arbeiten, verzeichnen nicht nur bessere Leistungen, sondern auch weniger Konflikte, mehr Wohlbefinden und Innovationsgeist.
Gibt es Beispiele, wo Personorientierung bereits gelebt wird?
Ja, vor allem im Elementar- und Grundschulbereich. Dort arbeiten viele Lehrpersonen intuitiv personorientiert – sie nehmen Kinder als Ganzes wahr, fördern individuelle Stärken, schaffen Vertrauen. Oft fehlt nur der theoretische Rahmen, um dieses Handeln auch bewusst zu reflektieren und strategisch weiterzuentwickeln. Wenn Schulteams dann verstehen, dass genau das Personorientierung bedeutet, entsteht ein Aha-Erlebnis: Sie erkennen, dass sie bereits viel richtig machen – und können darauf aufbauen.
Fortbildungen wie jene in Brixen sollen Lehrpersonen langfristig stärken. Wie gelingt es, dass die Impulse nicht verpuffen?
Indem man sie gemeinsam trägt. Ideal ist, wenn nicht nur eine, sondern mehrere Personen aus derselben Schule an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Dann können sie das Gelernte in ihre Einrichtung tragen, etwa in Form eines pädagogischen Tages. Wichtig ist auch, dass Schulleitungen dafüro ffen sind, um Strukturen zu schaffen, die eine nachhaltige Umsetzung ermöglichen. Studien zeigen: Schulen, die personorientiert arbeiten, verzeichnen nicht nur bessere Leistungen, sondern auch weniger Konflikte, mehr Wohlbefinden und Innovationsgeist.
Wenn Sie an die Schule der Zukunft denken – wie würde eine inklusive, begabungsfreundliche Schule aussehen?
Sie wäre ein Ort der Freude am Lernen. Ein Ort, an den Kinder und Erwachsene gerne hingehen, weil sie sich als Personen ernst genommen fühlen. Diese Schule wäre Teil einer Bildungsregion, vernetzt mit Betrieben, Kultureinrichtungen und digitalen Lernorten. Lernen findet nicht nur im Klassenzimmer statt, sondern in Projekten, in der Gemeinschaft, in der Welt. Das Ziel: Menschen dabei zu unterstützen, ihre Potenziale zu entfalten – auf ihre Weise, in ihrem Tempo, in ihrem Leben.