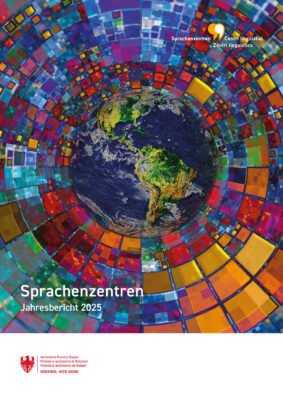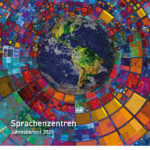Religionsunterricht im Fokus der Bildung
„Haltung braucht Halt“

Der Jesuit, Schulentwickler und Leiter des Bildungszentrums Heinrich Pesch Haus, Tobias Zimmermann SJ, spricht am „Tag des Religionsunterrichts“ in Brixen über Sinn, Halt und Haltung. Im INFO-Interview erläutert der Pädagoge, warum Schule mehr Lebensraum als Lernlabor sein sollte – und weshalb junge Menschen heute vor allem Zuversicht brauchen.
Tobias Zimmermann leitet das Zentrum für Ignatianische Pädagogik in Ludwigshafen, er ist Jesuit, Priester, Künstler und Pädagoge. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Frage: Wie können Schulen junge Menschen nicht nur fachlich, sondern auch menschlich stärken? Am 14. November 2025 spricht er beim „Tag des Religionsunterrichts“ in Brixen über „Haltung braucht Halt – Warum Schulen junge Menschen mit der Frage nach Sinn und Erfüllung im Leben nicht alleine lassen dürfen“. Im Gespräch mit INFO erklärt Zimmermann, was Haltung im pädagogischen Alltag bedeutet, warum Lehrkräfte selbst Halt brauchen – und weshalb Schule mehr Verantwortung übernehmen muss, wenn Familien, Vereine und Kirchen schwächer werden.
INFO: Herr Zimmermann, Sie sprechen in Ihrem Vortrag von „Haltung braucht Halt“. Was verstehen Sie unter Haltung im schulischen Kontext – und was gibt einer Haltung Halt?
Tobias Zimmermann: Wenn wir ehrlich sind, haben wir uns an ein sehr enges Bildungsverständnis gewöhnt: Schule soll Wissen vermitteln, Kompetenzen trainieren, junge Menschen fit für den Beruf machen. Das ist richtig, aber nicht genug. Bildung meint mehr als Ausbildung. Sie fragt: Wer will ich sein? oder noch stärker: Wer möchte ich einmal gewesen sein?
Das führt zu Fragen nach Haltung: Was trägt mich, wenn es schwierig wird? Warum lohnt es sich, ein anständiger Mensch zu sein? Und woher nehme ich die Zuversicht, dass Sinn und Moral nicht vergeblich sind?
Haltung entsteht dort, wo Kinder und Jugendliche erleben, dass Erwachsene selbst Haltung zeigen – Eltern, Lehrkräfte, Bezugspersonen. Deshalb ist Schule so bedeutsam: Je mehr Zeit junge Menschen dort verbringen, desto wichtiger wird, dass Lehrkräfte ihnen nicht nur Wissen, sondern auch eine Haltung zum Leben vermitteln.
Heute wird Schule vielfach als Leistungsraum verstanden, weniger als Lebensraum. Wie kann sie wieder ein Ort werden, an dem junge Menschen über Sinn, Werte und Orientierung sprechen dürfen?
Schule darf nicht auf ein Lernlabor reduziert werden. Wenn sie nur Leistung misst, verfehlt sie ihren Auftrag. Kinder lernen nicht allein durch Stoffvermittlung, sondern durch gelebte Beziehung. Schule ist ein sozialer Raum, ein Mikrokosmos der Gesellschaft.
Ich nenne das gern „Lebensraum Schule“. Dort müssen junge Menschen erleben, dass es Sinn macht, sich einzusetzen, Verantwortung zu übernehmen, sich gegenseitig zu respektieren.
Das kann nicht nur Aufgabe der Religionslehrerinnen und -lehrer sein. Haltung ist Querschnittsaufgabe. Lehrkräfte aller Fächer können vorleben, was es heißt, fair zu handeln, Fehler zuzugeben, Mitgefühl zu zeigen. Gerade in Zeiten, in denen vieles unsicher wird, ist Schule ein Ort, an dem man erfahren kann: Werte tragen.
Religionsunterricht darf kein exklusiver Ort sein, an dem nur eine kleine Gruppe solche Themen behandelt. Haltung und Sinn sind Querschnittsfragen. Wenn nur einzelne Lehrkräfte dafür zuständig sind, funktioniert es nicht.
Der Religionsunterricht ist oft der einzige Raum, in dem über Sinn- und Lebensfragen gesprochen wird. Welche Chancen, aber auch welche Grenzen sehen Sie hier?
Er hat beides – Chance und Grenze. Die Chance liegt darin, dass Religion diese Fragen nicht scheut: Woher komme ich, wofür lebe ich, was bleibt am Ende? Aber: Religionsunterricht darf kein exklusiver Ort sein, an dem nur eine kleine Gruppe solche Themen behandelt. Haltung und Sinn sind Querschnittsfragen. Wenn nur einzelne Lehrkräfte dafür zuständig sind, funktioniert es nicht.
Die Stärke des Religionsunterrichts liegt darin, dass er Räume öffnet, in denen man Fragen stellen darf, ohne sofort bewertet zu werden. Dass man dort Erfahrungen austauschen kann, die nicht in Noten passen. Und dass er Dialog ermöglicht – auch mit denen, die anders glauben oder gar nicht glauben. Schule sollte solche Räume kultivieren.
Viele Jugendliche suchen heute Sinn außerhalb institutioneller Religion. Wie kann Religionsunterricht diese Offenheit aufnehmen, ohne belehrend zu wirken?
Indem er die Menschen ernst nimmt. Die Zeit, in der man einfach Glaubenssätze vermittelt hat, ist vorbei. Heute wollen junge Menschen selbst Expertinnen und Experten ihres Lebens sein. Sie wollen sich ein eigenes Bild machen.
Deshalb braucht es eine neue Sprache des Glaubens – weniger Belehrung, mehr Dialog. Christlicher Glaube ist nicht Besitz, sondern Angebot.
Die Kirche muss sich daran gewöhnen, dass Überzeugung nicht mehr über Autorität entsteht, sondern über Erfahrung. Wenn junge Menschen erleben, dass Glauben auch Vernunft, Freiheit und Mitgefühl einschließt, dann wird Religion wieder relevant.
Sie fordern, dass Lehrpersonen über ihre eigene Haltung reflektieren. Wie gelingt es, im Berufsalltag aufrecht zu bleiben – trotz Überforderung und Frust?
Das ist eine der größten Herausforderungen. Lehrkräfte tragen enorme Verantwortung und stehen ständig unter Druck. In Deutschland, aber auch in Südtirol, wird noch zu wenig in kollegiale Beratung, Supervision und Teamentwicklung investiert.
Viele Lehrkräfte sind erschöpft – und merken es erst, wenn sie zynisch werden. Zynismus ist oft ein Schutzmechanismus gegen Überforderung.
Darum ist Selbstfürsorge keine Nebensache, sondern Teil der Professionalität. Lehrkräfte brauchen Räume, in denen sie selbst Halt finden: Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, Reflexion, geistige und emotionale Erholung. Nur wer selbst Halt hat, kann anderen Halt geben.
Junge Menschen brauchen das Gefühl, dass sie die Welt mitgestalten können. Schule kann das fördern, wenn sie nicht nur Wissen vermittelt, sondern Erfahrungen ermöglicht: Verantwortung übernehmen, Projekte gestalten, etwas verändern dürfen.
Wir leben in Krisenzeiten: Kriege, Klimawandel, gesellschaftliche Spaltung. Wie kann Schule Jugendlichen Halt geben, ohne sie zu überfordern?
Wir erleben tatsächlich eine Generation, die vieles durchschaut – aber wenig Hoffnung spürt. In unseren Studien sehen wir, dass der Wert „Zuversicht lernen“ in Schulen extrem niedrig ist. Das ist alarmierend. Denn Bildung ohne Zuversicht bleibt leer.
Junge Menschen brauchen das Gefühl, dass sie die Welt mitgestalten können. Schule kann das fördern, wenn sie nicht nur Wissen vermittelt, sondern Erfahrungen ermöglicht: Verantwortung übernehmen, Projekte gestalten, etwas verändern dürfen.
Manchmal wäre es heilsamer, gemeinsam den Jakobsweg zu gehen, statt über Lernstoff zu pauken – zu erleben, dass Weitermachen Sinn ergibt. Solche Erfahrungen prägen mehr als jede Schulnote.
Was zeichnet Schulen aus, die ihren Schülerinnen und Schüler wirklich Orientierung bieten?
Sie geben Vertrauen – und damit Verantwortung. Wenn Jugendliche merken, dass ihnen etwas zugetraut wird, wachsen sie über sich hinaus. Ich habe Schulen erlebt, in denen Schülerinnen und Schüler Elternsprechtage organisieren oder soziale Projekte leiten – und mit welcher Reife sie das tun.
Orientierung entsteht nicht durch Vorschriften, sondern durch Teilhabe. Schülerinnen und Schüler brauchen Räume, in denen sie Wirksamkeit erfahren, in denen sie merken: Ich kann etwas bewirken. Schulen, die das ermöglichen, prägen starke Persönlichkeiten – und das ist letztlich das Ziel jeder Bildung.
Manche sagen, Schule soll Wissen vermitteln, nicht Sinn stiften. Warum halten Sie das für zu kurz gegriffen?
Früher haben Familien, Vereine oder Kirchen viele Bildungsaufgaben übernommen. Diese Institutionen sind schwächer geworden, und das hat Folgen.
Heute ist Schule oft der letzte Ort, an dem Kinder verlässlich Gemeinschaft erleben. Natürlich kann sie nicht alles kompensieren, aber sie darf sich dieser Verantwortung auch nicht entziehen.
Je mehr andere Lebensräume wegbrechen, desto stärker muss Schule ein Ort sein, an dem Kinder soziale, emotionale und moralische Kompetenzen entwickeln. Ob das wünschenswert ist, lässt sich diskutieren – aber es ist die Realität unserer Zeit. Aber dann müssen Schulen und Lehrkräfte darin unterstützt werden, diese Aufgaben zu stemmen – durch berufsbegleitende Fortbildungsformate, durch neue Formen der Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams, durch Freiräume, um Neues auszuprobieren und geeignete Schulräume, die mehr sind als Lernkasernen.
Wenn Sie einen Wunsch an die Bildungspolitik hätten – welcher wäre das?
Ich wünsche mir mehr Vertrauen in die Schulen selbst. Weniger Standardisierung, mehr Freiheit. Schulen sind unterschiedlich – ihre Kinder, ihre Lebenswelten, ihre Herausforderungen. Wir müssen den Schulteams vor Ort zutrauen, dass sie wissen, was ihre Schülerinnen und Schüler brauchen.
Bildung entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch Mut, Verantwortung zu übernehmen und durch Vertrauen in die, die Verantwortung tragen. Wenn wir das verstehen, dann wird Schule wieder zu dem, was sie sein sollte: ein Ort, an dem junge Menschen wachsen – an Wissen, an Haltung, an Menschlichkeit.