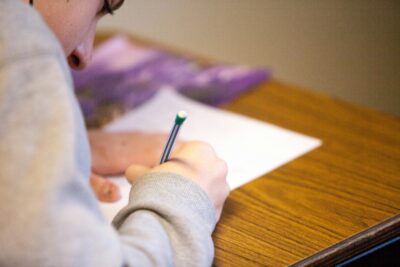„Wir verhindern Lernen durch Unterricht“

Stefan Ruppaner gilt als einer der radikalsten Schulreformer Deutschlands. An der Alemannenschule im baden-württembergischen Wutöschingen hat er das klassische Schulsystem auf den Kopf gestellt – und zeigt, wie Lernen ohne Unterricht besser funktioniert – auch für Schulen in Südtirol.
Stefan Ruppaner, viele Jahre Schulleiter der Alemannenschule im süddeutschen Wutöschingen, ist kein Mann für halbe Sachen. Wo andere über Reformen reden, hat er sie umgesetzt. An seiner Schule gibt es keine klassischen Klassenräume, keine starren Stundenpläne, keine Noten im herkömmlichen Sinn. Statt Lehrerinnen und Lehrer begleiten „Lernbegleiterinnen“ und „Lernbegleiter“ die Kinder auf individuellen Lernwegen, dokumentiert auf einer digitalen Plattform, sichtbar für Eltern, Lernende und Team.
Die Alemannenschule ist eine Gemeinschaftsschule, die Kinder und Jugendliche von Klasse 1 bis 13 begleitet – sie gilt heute als eine der fortschrittlichsten Schulen Deutschlands und wurde 2019 mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet: Sie kombiniert Selbstorganisation, Coaching und digitale Lernprozesse – und erreicht mit diesem Ansatz in Vergleichsarbeiten regelmäßig überdurchschnittliche Ergebnisse.
Ihr Erfolg spricht sich herum. Regelmäßig reisen auch Delegationen aus Südtirol nach Wutöschingen, um sich das Raum-Zeit-Konzept mit Marktplatz und Lernatelier, die Coaching-Struktur und die „Schmetterlingspädagogik“ anzusehen. Derzeit ist Ruppaner selbst in Südtirol unterwegs: im Schloss Rechtenthal für die Deutsche Bildungsdirektion, an der Grundschule Auer, an der Sozialwissenschaftlichen Fachoberschule Bozen und zwei Tage in der pädagogischen Abteilung der Bildungsdirektion. Überall stellt er dieselbe Frage: Wie verwandeln wir die Schule vom Ort des Lehrens in einen Ort des Lernens?
Wenn Ruppaner sagt, „Unterricht ist Zeitverschwendung“, dann meint er das wörtlich. Im Gespräch erklärt er, warum Vertrauen mehr bewirkt als Kontrolle, warum Fehler erwünscht sind – und warum die Schule nur dann Zukunft hat, wenn sie die Kinder wirklich ernst nimmt.
INFO: Herr Ruppaner, Sie haben einmal gesagt: „Unterricht ist Zeitverschwendung.“ Warum?
Stefan Ruppaner: Weil der Unterricht den Kindern die Zeit zum Lernen nimmt. Meine Tochter hat mir oft gesagt: „Papa, schreib mir eine Entschuldigung, ich bleibe heute zu Hause, ich will lernen.“ Und sie war damit nicht allein – viele Jugendliche sagen das. Sie schwänzen die Schule, um wirklich lernen zu können. Daran sieht man, wie absurd das System ist: Wir nehmen den Kindern ihre Lernzeit, weil wir sie in Strukturen pressen, die ihnen fremd sind.
Was hat Sie persönlich dazu bewegt, Schule so radikal neu zu denken? Gab es ein Schlüsselerlebnis?
Ja. 2007 sah ich zufällig im Fernsehen den Film „Treibhäuser der Zukunft“ von Reinhard Kahl. Darin wurden Schulen gezeigt, an denen Achtklässler selbstständig lernten – ohne Frontalunterricht. Ich hielt das zunächst für eine Inszenierung. Dann bin ich an die Bodenseeschule in Friedrichshafen gefahren, um es mit eigenen Augen zu sehen. Und dort habe ich verstanden: Es geht wirklich. Man kann eine Schule bauen, in der das Lernen im Mittelpunkt steht – nicht das Lehren.

Und dann haben Sie Ihr eigenes System umgekrempelt?
Genau. Ich habe mir gesagt: Wenn die das können, können wir das auch. Wir haben ein Materialnetzwerk gegründet und Lernmaterialien entwickelt, die selbstorganisiertes Lernen ermöglichen. Später kam die Digitalisierung dazu – der eigentliche Gamechanger. Heute läuft bei uns fast alles über eine digitale Lernplattform: Jede Schülerin und jeder Schüler plant dort die Woche, dokumentiert Lernfortschritte, lädt Ergebnisse hoch, reflektiert im Coaching. Eltern sehen transparent, was passiert. So entsteht eine Lernkultur der Eigenverantwortung.
Wie reagierte die Schulbehörde?
Wir haben gar nicht erst gefragt – wir haben einfach angefangen. Als Baden-Württemberg die Gemeinschaftsschulen einführte, war Innovation plötzlich erlaubt. Wir haben diese Freiheit genutzt. Heute ist die Schule überlaufen: 160 Anmeldungen für 80 Plätze. Eltern sehen, dass Kinder hier gerne lernen.
Wie sieht ein typischer Schultag an der Alemannenschule aus?
Der Tag beginnt flexibel. Viele Kinder kommen schon vor acht Uhr, manche um sieben, um in Ruhe zu lernen oder Musik zu machen. Über die Woche verteilt gibt es Input-Stunden – etwa in Deutsch, Mathe oder Englisch. Wer mag, geht hin – wer nicht, arbeitet an eigenen Themen.
Wichtigster Fixpunkt ist das wöchentliche Coaching. Jede Schülerin und jeder Schüler hat 15 Minuten mit seiner Lernbegleiterin oder seinem Lernbegleiter. Wir sprechen nicht nur über Ziele und Gelingensnachweise, sondern auch über das Leben: Wie geht’s zu Hause? Wie war das Wochenende? Wo hakt’s gerade? Das Gespräch wird auf der Plattform festgehalten, damit Kind, Eltern und Coach den Prozess gemeinsam im Blick haben.
Nachmittags gibt es Clubs – Musik, Theater, Sport, Naturprojekte, Handwerk. Lernen endet bei uns nicht mit der Schulglocke, sondern dort, wo Neugier beginnt.
Sie haben die Schule auch räumlich völlig neu gestaltet.
Wenn man Schule neu denkt, muss man Raum, Zeit und Expertise neu denken. Wir haben keine Klassenzimmer mehr, sondern Lernlandschaften. Wer konzentriert arbeiten will, bleibt im Lernatelier – dort herrscht Flüsterkultur. Wer gemeinsam arbeitet, geht auf den Marktplatz – das ist unser Co-Working-Space. Und wer Input braucht, besucht den Inputraum. Lernen findet auch im Freien statt – im Wald, am Fluss, im Dorf. Raum wirkt auf Haltung: Wer sich bewegen darf, denkt freier.

Wie behalten Sie bei so viel Freiheit den Überblick?
Durch Vertrauen und klare Strukturen. Wir haben ein Graduierungssystem: Neue Kinder sind „Starter“, werden eng begleitet und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Wer zuverlässig arbeitet, wird „Durchstarter“ und darf Zeit und Ort selbst wählen. Die höchste Stufe ist der „Lernprofi“. Diese Jugendlichen haben gezeigt, dass sie Verantwortung für sich und andere übernehmen können. Sie besitzen Schlüssel zur Schule und können auch abends oder am Wochenende kommen. Über 80 Prozent unserer Schülerinnen und Schüler sind heute Durchstarter oder Lernprofis – das zeigt, dass Freiheit funktioniert, wenn sie auf Beziehung basiert.
Sie sprechen oft von „reziprokem Lernen“. Was meinen Sie damit?
Das ist Lernen durch Lehren. Wenn ein Siebtklässler einem Fünftklässler etwas erklärt, vertieft er sein eigenes Wissen – beide profitieren. In herkömmlichen Schulen geht das kaum, weil Altersgruppen getrennt werden. Bei uns lernen Jahrgänge 5 bis 10 gemeinsam. So entsteht eine Lernkultur wie in jeder guten Werkstatt: Man schaut sich etwas ab, hilft sich gegenseitig – Lernen als soziales Geflecht.
Funktionierte das von Anfang an?
Ja, erstaunlich gut. Wir dachten zuerst, es liegt am ersten Jahrgang, dass alles so reibungslos läuft. Aber die Leistungen blieben hoch – trotz vieler Kinder ohne Gymnasialempfehlung. Wir schauen auf den Menschen, nicht auf den Lehrplan. Wer sich wohlfühlt, lernt automatisch besser.
Und die, die keine Lust haben zu lernen?
Die gab es anfangs, klar. Wir hatten eine Chill-Ecke für alle, die nichts machen wollten. Nach drei Wochen war sie leer. Wenn niemand mehr kommt und dich zwingt, wird Nichtstun schnell langweilig. Wir kümmern uns um die, die wollen – und das steckt an. Motivation wächst aus Freiheit, nicht aus Druck.
Wie reagieren Kinder, die mit dieser Freiheit überfordert sind?
Sie bekommen intensive Begleitung. Das wöchentliche Coaching hilft enorm. Wir fragen: „Wie geht’s dir? Was brauchst du?“ Manchmal reicht Zuhören, manchmal braucht es Strukturhilfe. Wichtig ist Beziehung. Viele Kinder kommen aus Schulen, in denen sie sich als Versager fühlten. Bei uns erleben sie: Ich kann was. Dann kommt der Rest von allein.
Und wie hat sich dadurch der Lehrerinnen- und Lehrerberuf verändert?
Total. Wir nennen sie Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter, nicht Lehrerinnen und Lehrer. Sie sind Coach, Beraterin und Berater, Vertrauensperson – nicht Wissensvermittler. Wir nehmen ihnen bewusst das Klassenzimmer, um alte Muster zu durchbrechen. Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter sind präsent, führen Gespräche, trösten, motivieren.
Sie arbeiten 35 Stunden in der Schule, aber ohne Korrekturen und Nachbereitung daheim. Diese Zeit fließt in echte Begegnung. Unterrichtsvorbereitung fällt weg – dafür gewinnen wir Beziehung.

Wie gehen Sie mit Leistung und Fehlern um?
Wir bewerten nicht, wir begleiten. Ein Kind zeigt, was es kann – wann es soweit ist. Das nennen wir Gelingensnachweis. Wenn etwas fehlt, gibt’s Feedback, dann wird geübt und erneut geprüft. So entsteht eine Kultur des Lernens statt des Bewertens. Fehler sind willkommen – sie zeigen, wo’s noch Potenzial gibt.
Und ja: Unsere Schülerinnen und Schüler schreiben am Ende ganz normale Prüfungen und Abitur. Sie schneiden meist besser ab als der Landesdurchschnitt.
Welche Rolle spielt Gemeinschaft im Vergleich zur individuellen Leistung?
Eine sehr große. Lernen ist immer sozial. Kinder bilden Teams, setzen sich Ziele, reflektieren gemeinsam. Ob Musical, Waldwoche oder Tiny-House-Projekt – sie entscheiden, was sie tun wollen, und tragen Verantwortung. Wer ein Musical probt, lernt Kommunikation, Disziplin und Mut. Wer im Wald lebt, lernt Teamgeist und Selbstständigkeit. Jeder wächst dort, wo er Sinn erlebt.
Und Kreativität?
Die ist zentral. Wir haben die sogenannten 5W-Tage – „Was wir wirklich wissen wollen“. Da bestimmen die Kinder selbst Themen, ohne Lehrplanvorgabe. Einige wollten wissen, wie es im Gefängnis ist. Also haben sie den Alltag dort erlebt. Andere forschten zu Ameisenstaaten oder entwarfen eigene Lern-Apps. Kreativität entsteht, wenn man darf. Langeweile ist dabei der beste Motor.
Wie steht es um Inklusion und Vielfalt?
Wir haben viele Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen – auch Autistinnen und Autisten. Für sie ist das Lernatelier ideal, weil es ruhig ist. Andere brauchen Bewegung, Austausch, Geräusche – dafür gibt’s den Marktplatz. Jeder findet seinen Platz. Wir definieren Kinder nicht über Defizite, sondern über Möglichkeiten.
Welche Rolle spielen die Eltern?
Eine große. Sie sind über die Plattform immer informiert. Wir führen regelmäßig Elterngespräche, aber auf Augenhöhe. Manche Eltern müssen erst lernen, loszulassen – sie fragen: „Lernt mein Kind genug?“ Dann sage ich: „Schauen Sie hin – es arbeitet freiwillig!“ Wenn Eltern sehen, dass ihre Kinder morgens gerne kommen, ist das die beste Antwort.

Digitalisierung wird oft als Bedrohung gesehen. Sie sprechen dagegen von Chancen.
Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug. Sie befreit Zeit. KI kann Aufgaben organisieren, Rückmeldungen geben, Texte verbessern – wunderbar. Aber das Herz bleibt menschlich. Ein Avatar kann kein Kind trösten oder motivieren. Deshalb nennen wir unsere Haltung Schmetterlingspädagogik: Die eine Flügelhälfte steht für selbstorganisiertes, digitales Lernen, die andere für Lernen durch Erleben – Musicals, Bergtouren, Baumhausbau. Das Digitale schafft Zeit für das Menschliche.
Wie arbeiten Sie im Kollegium zusammen?
Wir haben Teams statt Hierarchien – sogenannte Quadrigen. Vier Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter arbeiten für eine Jahrgangsgruppe. Sie planen, reflektieren, vertreten sich gegenseitig. Entscheidungen fallen im Team, nicht oben. So entsteht Vertrauen, Kreativität und gegenseitige Unterstützung – das Gegenteil von Einzelkämpfertum.
Glauben Sie, dass Ihr Modell übertragbar ist?
Ja, und viele Schulen tun es bereits. In Luxemburg, Österreich und Deutschland entstehen ähnliche Strukturen. Das Problem sind starre Gesetze. Die Schulpflicht wurde einst eingeführt, um Kinder vor Ausbeutung zu schützen – heute verhindert sie oft flexible Lernformen. Wir müssen mutiger werden.
Was wünschen Sie sich für die Schule der Zukunft?
Dass sie endlich wieder um die Kinder kreist. Dass sie Orte sind, an denen man Sinn, Freude und Gemeinschaft erlebt. Wenn Kinder gerne zur Schule gehen, wenn sie lachen, neugierig sind und sich ernst genommen fühlen – dann funktioniert alles andere von selbst. Wir müssen nur aufhören, sie ständig zu unterrichten.