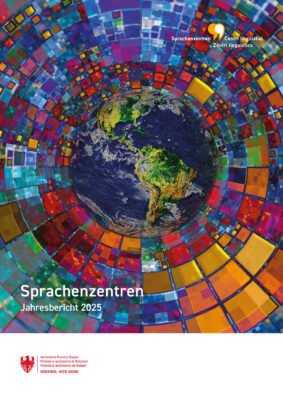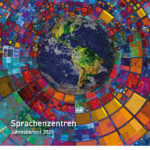Kommentar
Wert der Mehrsprachigkeit schätzen
“As diversity grows – so must we.“ Wieso Gary R. Howards Mantra zur sprachlichen Situation an Südtiroler Schulen passt.
Was für eine Ehre, die erste Kursfolge „Mehrsprachigkeitsdidaktik“ begleiten zu dürfen! Es geht um theoretische und praktische Kenntnisse der Mehrsprachigkeitsdidaktik, Lehrerinnen und Lehrer sollten mehrsprachiges und sprachsensibles Lernen initiieren, planen, durchführen und evaluieren können. Die Ziele verweisen darauf, dass Mehrsprachigkeit jene Normalität ist, um deren Gestaltung es in der Schule geht. Zu oft verengt sich Mehrsprachigkeitsdidaktik anderswo auf sprachsensiblen Unterricht und damit auf eine einzige Sprache. Nicht so in Südtirol. Das Vorhandensein von drei Landessprachen und die sicht- und hörbare alltägliche Mehrsprachigkeit machen eine solche, auch anderswo problematische, Reduktion sinnlos. Fremdsprachen und die Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler ergänzen ein Bild, das von den Lehrpersonen in der Kursfolge als herausfordernd und oft auch konfliktuell beschrieben wird.
Wie anderswo gibt es auch in Südtirol Vorstellungen, wie (eine bestimmte) Sprache zu sein hat oder wie sich Menschen sprachlich verhalten sollten. Solche Ansichten über Sprache und Sprachverhalten haben eine Tradition und sind gut verankert, aber sie sind auch veränderbar. Derzeit steht die gewohnte Mehrsprachigkeit auf dem Prüfstand. Die wachsende Wahrnehmung der Sprachen der Migration verlangt nach Veränderung. Ist es nicht schon kompliziert genug, Italienisch, Deutsch und an vielen Standorten Ladinisch einen Platz zu verschaffen, der den Schülerinnen und Schülern nachhaltige Kompetenzentwicklung in der Sprache und in den Fächern zusichert? In ihrer Antwort sieht sich die Schule mit der zentralen Frage des Ein- und Ausschlusses konfrontiert. Eine inklusive Schule gründet ihre Schulsprachenpolitik in einem umfassenden Verständnis von Mehrsprachigkeit. Aus dem vierten Ziel für nachhaltige Entwicklung lassen sich die zentralen Fragen ableiten: Wie kann Wertschätzung von Mehrsprachigkeit umgesetzt werden? Wie kann mehrsprachige Teilhabe am Unterricht ermöglicht werden? Wie können Schülerinnen und Schüler auf eine mehrsprachige Welt vorbereitet werden? Das Mehrsprachencurriculum ist ein guter Rahmen dafür.
Wertschätzung von Mehrsprachigkeit und Vorbereitung auf eine mehrsprachige Welt sind Aufgaben, für die viele spannende Lösungswege an den Schulstandorten verwirklicht werden, wie sich an den Projekten zeigt, die zum Abschluss der Kursfolge präsentiert wurden.
Eva Vetter Professorin für Fachdidaktik/Sprachlehr- und -lernforschung an der Universität Wien
Demgegenüber ist die Entwicklung pluraler Formen der Teilhabe (fast) noch eine Leerstelle. Angesprochen sind insbesondere Sachfächer. Wie sieht Unterricht aus, der ein bestimmtes Thema, beispielsweise Klimaschutz, mehrsprachig bearbeitet? Wie kann der Vorteil von Mehrsprachigkeit für das Sachlernen genützt werden? Wie können alle Schülerinnen und Schüler verschiedene sprachlichen Ressourcen einbeziehen und am Lernprozess aktiv teilhaben? Es würde nicht überraschen, wenn die Südtiroler Schulen und ihre Lehrerinnen und Lehrer auch bei dieser Entwicklung eine Vorreiterrolle spielten