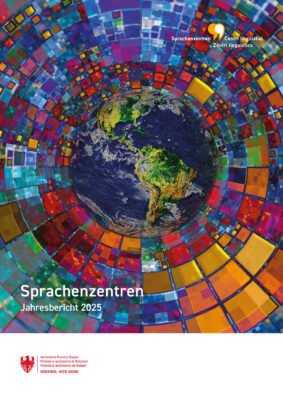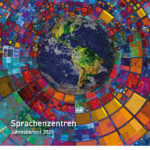Interview mit Alexandra Pedrotti
Musik ist für alle da

Alexandra Pedrotti ist Landesdirektorin der Deutschen und Ladinischen Musikschulen in Südtirol. Im Gespräch mit INFO zieht sie Bilanz über das vergangene Schuljahr – mit Themen wie musikalischer Frühförderung, wachsender Nachfrage, Digitalisierung, Inklusion und einem Herzensprojekt, das Grenzen sprengt.
Seit dem 1. September 2022 ist Alexandra Pedrotti Landesdirektorin der Musikschulen in Südtirol. Die gebürtige Pfattnerin besuchte das Klassische Gymnasium „Walther von der Vogelweide“ und studierte Klarinette am Konservatorium „Claudio Monteverdi“ in Bozen. Nach ihrem Abschluss in Musikwissenschaft und Geschichte an der Universität Innsbruck sowie am Istituto di Musicologia der Universität Venedig unterrichtete Alexandra Pedrotti Klarinette, Musiktheorie und Kammermusik an der Musikschule Unterland. Ab 2011 war sie außerdem pädagogisch-didaktische Mitarbeiterin in der Landesmusikschuldirektion und ab 2015 wechselte sie in die Führungsrolle als Direktorin der Musikschulen von Sterzing und Unterland. Vor ihrer Ernennung zur Landesdirektorin war sie zudem stellvertretende Direktorin der Deutschen und Ladinischen Musikschule. Im Interview mit INFO blickt sie zurück auf das vergangene Schuljahr, auf musikalische Höhepunkte, strukturelle Herausforderungen – und auf ein Herzensprojekt, das Inklusion nicht nur verspricht, sondern lebt.
INFO: Sie blicken auf ein weiteres Jahr als Landesdirektorin der Musikschulen zurück. Was waren für Sie die Höhepunkte des vergangenen Musikschuljahres?
Alexandra Pedrotti: Es ist nicht leicht, einzelne Höhepunkte zu benennen – es gab viele. Einer der wichtigsten ist sicherlich, dass sich die Musikschulen in Südtirol weiterhin großer Beliebtheit erfreuen. Nach den Einbrüchen während der Corona-Pandemie – wir hatten damals rund zehn Prozent weniger Schülerinnen und Schüler – hat sich die Lage wieder vollständig stabilisiert. Die Nachfrage ist heute so hoch wie nie. Im Schuljahr 2024/25 wurden 17.200 Schülerinnen und Schüler aufgenommen – das waren 650 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr und das ohne zusätzliche Ressourcen. Im kommenden Jahr liegen bereits mehr Anfragen vor, als wir eigentlich bedienen können. Dennoch haben wir Wege gefunden, möglichst vielen ein musikalisches Angebot zu machen, etwa durch gezielte Kooperationen.
Welche Aufgaben leiten Sie daraus für die Musikschulen ab?
Unsere Aufgaben lassen sich in drei Hauptbereiche gliedern:
Erstens: die Breitenförderung. Unser Ziel ist es, allen Kindern einmal im Leben ein musikalisches Angebot zu ermöglichen. Deshalb arbeiten wir eng mit Kindergärten und Schulen zusammen – jedes Kind soll in den Genuss musikalischer Frühförderung kommen.
Zweitens: die Begabten- und Studienvorbereitungsförderung. Wir unterstützen Schülerinnen und Schüler gezielt, etwa bei Leistungsabzeichen oder Wettbewerben, und fördern auch die Ensemblearbeit. Ein Highlight in diesem Zusammenhang war für mich die Neugründung des Landesjugendorchesters. Nach der pandemiebedingten Pause fand im März 2025 ein beeindruckendes Konzert im Kursaal Meran statt – unter der Leitung von Edwin Cáceres-Penuela, einem erfahrenen Geiger und hervorragenden Dirigenten, der eine große Stärke in der Kommunikationskultur mit Jugendlichen aufweist. Die Konzertreihe fand im Rahmen von Musik Meran statt und hat dem Orchester die Bühne gegeben, die es verdient.
Und drittens: unser kultureller Auftrag. Wir pflegen eine enge Zusammenarbeit mit musikalischen Vereinen und Verbänden, wie dem Südtiroler Chorverband, dem Südtiroler Volksmusikverein oder dem Verband der Südtiroler Musikkapellen. Letzteren unterstützen wir etwa durch die Durchführung der theoretischen und praktischen Prüfungen bei Leistungsabzeichen – jährlich sind dies über 1.000 Schülerinnen und Schüler.

Gibt es ein Projekt, auf das Sie besonders stolz sind?
Ja, das bereits erwähnte neu gegründete Landesjugendorchester Südtirol liegt mir sehr am Herzen, da dies alle musikalischen Ausbildungsstätten des Landes (alle 3 Bildungsdirektionen und das Konservatorium Bozen) und alle drei Sprachgruppen vereint – aber auch unser neues Projekt „Sommermusikwoche – Musik ohne Grenzen”. Dabei verbringen Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen drei Tage mit Musik, Tanz und Choreografie. Es geht darum, Ausdrucksmöglichkeiten zu schaffen, und gemeinsam kreativ zu sein. Petra Linecker, eine Expertin für inklusives Musizieren, begleitet das Projekt. Heuer nehmen insgesamt 20 Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters daran teil – für mich ein echtes Herzensprojekt.
Wie hat sich die Nachfrage nach Musikunterricht in den letzten Jahren entwickelt?
Die Nachfrage ist ungebrochen hoch – und das ist Fluch und Segen zugleich. Kinder, die durch musikalische Frühförderung begeistert werden, wollen natürlich auch ein Instrument erlernen. Diesem berechtigten Anspruch gerecht zu werden, ist eine große Herausforderung, gerade angesichts begrenzter Ressourcen.
In welchen Bereichen gibt es noch besonderen Handlungsbedarf?
Den größten Nachholbedarf haben wir sicherlich im Bereich des Mangels an qualifiziertem Lehrpersonal. Vor allem die Tatsache, dass das Erlangen der Lehrbefähigung in Italien steten Veränderungen unterworfen und oftmals sehr langwierig ist, bereitet uns Schwierigkeiten. Denn die Konsequenz ist, dass sehr viele Studentinnen und Studenten ihr lehrbefähigendes Musikstudium im Ausland absolvieren und oftmals auch dort eine Arbeit als Musikpädagogin oder Musikpädagoge annehmen und nicht mehr nach Südtirol zurückkehren. Die Deutsche Bildungsdirektion ist aber derzeit dabei, gemeinsam mit dem Konservatorium Bozen einen Lehrgang für den Erwerb der Lehrbefähigung zu installieren, der bereits im kommenden Schuljahr starten wird. Dies sollte diese angespannte Situation etwas entschärfen.
Ein besonderes Anliegen ist mir die Vernetzung der Landesdirektion Musikschule mit den Partnern im Bildungsbereich.
Wie hat die Pandemie den digitalen Wandel in der Musikschule beeinflusst?
Corona war in dieser Hinsicht ein Weckruf. Viele Lehrpersonen hatten Schwierigkeiten, auf digitale Unterrichtsformen umzustellen – das zeigte uns deutlich, dass es hier Weiterbildungsbedarf gibt. Gleichzeitig eröffnet die Digitalisierung neue Chancen: etwa durch schnelle Rückmeldungen über Videoaufnahmen, durch besseren Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrpersonen, und durch die Dokumentation von Abschlusskonzerten, die wir mittlerweile auf YouTube veröffentlichen.
Und wie sieht es mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz aus?
Da stehen wir noch ganz am Anfang. Potenziell kann KI eine hilfreiche Unterstützung für Lehrpersonen sein – zum Beispiel bei der Simulation von Prüfungssituationen. Aber es besteht natürlich auch Missbrauchsgefahr. Wir sind hier vorsichtig, aber offen.
Was steht im neuen Schuljahr auf dem Programm?
Ein besonderes Anliegen ist mir die Vernetzung der Landesdirektion Musikschule mit den Partnern im Bildungsbereich. Hervorheben möchte ich dabei eine Arbeitsgruppe der Bildungsdirektion, die einen neuen Leitfaden für die Zusammenarbeit zwischen Musikschulen, Kindergärten und Schulen erarbeitet hat. Außerdem gibt es eine Neuauflage unseres musikalischen Adventskalenders „Adventstöne“, der auf Rai Südtirol ausgestrahlt wird – mit Musik von Schülerinnen und Schülern aus dem ganzen Land.
Am 1. September gestalten wir den Pädagogischen Eröffnungstag mit einem Auftritt von „Musik ohne Grenzen“. Zudem widmen wir uns verstärkt der Musikerinnen bzw. Musiker-Gesundheit – mit Fortbildungen zum Vorbeugen von Haltungsschäden, zum Umgang mit Lampenfieber und mit mentaler Belastung. Auch die Feedbackkultur ist ein Thema: Wir möchten sicherstellen, dass Rückmeldungen zu Leistungsabzeichen konstruktiv und motivierend sind. Hier arbeiten wir mit Expertinnen wie Christine Thielemann zusammen.