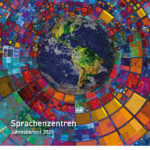Interview mit Heinrich Videsott
„Die Welt steht euch offen – bleibt neugierig!“

Heinrich Videsott ist neuer Landesdirektor der ladinischen Kindergärten und Schulen. Im Interview mit INFO spricht er über seine Ziele, die Herausforderungen der Mehrsprachigkeit und die Bedeutung der ladinischen Identität.
Heinrich Videsott leitet seit November 2024 die Landesdirektion ladinische Kindergärten und Schulen. Der 1969 in Bruneck geborene Videsott bringt umfangreiche Erfahrung mit: Nach über 20 Jahren als Lehrer für Mathematik und Naturwissenschaften war er von 2010 bis 2017 Bürgermeister von St. Martin in Thurn und leitete danach den Schulsprengel St. Vigil in Enneberg. Als Vertreter der Direktorinnen und Direktoren sowie Inspektorinnen und Inspektoren der ladinischen Sektion des Landesschulrates ist er seit Jahren in die Bildungslandschaft eingebunden. Jetzt übernimmt er die Verantwortung für die ladinischen Kindergärten und Schulen – mit dem Ziel, die ladinische Sprache und Kultur weiter zu stärken und die Schule an neue Herausforderungen anzupassen. Im Interview mit INFO spricht er über seine Pläne und seinen Blick auf die Zukunft der ladinischen Bildung.
INFO: Herr Videsott, Sie haben eine lange Erfahrung als Lehrer, Direktor und auch als Bürgermeister. Was hat Sie motiviert, das Amt des ladinischen Schulamtsleiters zu übernehmen?
Heinrich Videsott: Ich bin nicht jemand, der seinen Lebensweg lange im Voraus plant. Ich bin eher zufällig Direktor und Bürgermeister geworden – es hat sich einfach so ergeben. Als sich die Möglichkeit bot, mich für das Amt des Schulamtsleiters zu bewerben, hat mich das gereizt. Ich bin ein neugieriger Mensch, ich finde es spannend herauszufinden, wie Dinge und Strukturen funktionieren. Herausforderungen motivieren mich. Seit dem 1. November bin ich nun Schulamtsleiter und mache mir vorerst ein Bild von meiner neuen Aufgabe.
Was ist Ihr erster Eindruck von Ihrer neuen Aufgabe?
Es gibt viele Sitzungen und zahlreiche Themen, die geklärt werden müssen. Besonders herausfordernd ist, dass aus Rom ständig neue Bestimmungen und Vorgaben kommen, die wir anpassen müssen.
Was sind Ihre wichtigsten Ziele für die ladinischen Kindergärten und Schulen?
Mein oberstes Ziel ist es, die ladinische Sprache und Kultur zu bewahren und weiterzuentwickeln – sie sind das Herzstück unserer Identität. Gleichzeitig müssen wir uns mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen, die nicht nur die ladinischen Schulen, sondern ganz Europa betreffen, wie zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund oder der Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf den Unterricht.

Die ladinische Schule ist einzigartig durch ihr paritätisches, mehrsprachiges System. Welche Herausforderungen sehen Sie hier und wie möchten Sie diese angehen?
Das ladinische Modell wurde ursprünglich für unsere Täler konzipiert, als die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen noch andere waren. Mittlerweile hat sich die Situation verändert – es gibt eine größere sprachliche Vielfalt, auch durch Zuzug aus anderen Regionen Italiens oder aus dem Ausland. Unsere Herausforderung ist es, die Qualität unseres mehrsprachigen Unterrichts sicherzustellen und weiterzuentwickeln.
In den letzten Jahren hat sich der Bildungssektor stark verändert. Welche Entwicklungen sehen Sie als besonders wichtig für die ladinischen Schulen?
Die Personalisierung des Unterrichts wird immer wichtiger. Die Schülerinnen und Schüler sind sehr unterschiedlich, und eine Schule, die jede und jeden individuell fördert, ist unser Ziel – auch wenn das nicht immer einfach ist. Zudem stellt die Künstliche Intelligenz wie gesagt eine große Herausforderung für das Bildungssystem dar.
Die ladinische Sprache und Kultur zu fördern, ist eine zentrale Aufgabe der Schulen. Wie kann dies im Schulalltag noch stärker verankert werden?
In den letzten Jahren wurde bereits viel getan, um die ladinische Sprache in ihrer Reinheit zu bewahren – und das ist teilweise auch gelungen. Es ist wichtig, diesen Weg weiterzugehen. Mit neuen Unterrichtsmaterialien – insbesondere in Fächern wie Geographie, aber auch durch regionale Geschichten und lokale Besonderheiten – können wir unsere Kultur noch stärker im Schulalltag verankern.
Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler in allen drei Sprachen ein hohes Niveau erreichen.
Welche Rolle spielt die Mehrsprachigkeit für die Zukunft der ladinischen Gemeinschaft?
Eine zentrale Rolle – sie war für uns nie eine bewusste Entscheidung, sondern eine Notwendigkeit. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Schülerinnen und Schüler in allen drei Sprachen ein hohes Niveau erreichen. Unser System funktioniert gut, aber es gibt noch Luft nach oben.
Wie sehen Sie die Zusammenarbeit mit den Schulen, Lehrpersonen und Eltern? Gibt es neue Ansätze, die Sie einbringen möchten?
Schon als Direktor war mir eine offene Zusammenarbeit wichtig. Ich habe stets einen niederschwelligen Zugang gepflegt und war für Kritik und Anregungen offen. Das möchte ich in meiner neuen Funktion beibehalten. Auch wenn ich in Bozen sitze – meine Tür steht immer offen. Ich bin kritikfähig und dankbar für Vorschläge.
Welche digitalen oder pädagogischen Innovationen möchten Sie in den Schulen fördern?
Kürzlich wurde ein Profil für die ladinischen Schulen ausgearbeitet. In Zukunft wollen wir die Personalisierung des Lernens stärker fördern. Im digitalen Bereich stellt die Künstliche Intelligenz – ich wiederhole mich – eine große Herausforderung dar, mit der wir uns intensiv beschäftigen müssen. Zudem möchten wir externe Lernorte stärker einbinden – beispielsweise die Geologie der Dolomiten direkt in der Natur erlebbar machen oder bei Übernachtungen auf Almhütten die sozialen Kompetenzen und das Gemeinschaftsgefühl stärken.
Wenn unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin gerne zur Schule gehen, motiviert lernen und sich wohlfühlen, dann wäre das für mich ein Erfolg.
Wenn wir in fünf Jahren zurückblicken: Woran würden Sie erkennen, dass Ihre Arbeit erfolgreich war?
Das ist eine Frage der Perspektive – ob ich meine Arbeit als erfolgreich betrachte oder ob andere das tun. Wenn unsere Schülerinnen und Schüler weiterhin gerne zur Schule gehen, motiviert lernen und sich wohlfühlen, dann wäre das für mich ein Erfolg.
Gibt es eine Botschaft, die Sie den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen zum Start Ihres Amts mitgeben möchten?
Unterrichten ist der schönste Beruf der Welt. Es ist eine Herausforderung, aber eine gelungene Unterrichtseinheit kann auch für die Lehrperson unglaublich bereichernd sein. Besonders schön ist es, wenn ein Schüler oder eine Schülerin Jahre später auf einen zukommt und sagt, dass er oder sie sich gerne an die Schulzeit erinnert und dass man eine „gute“ Lehrkraft war.
Den Schülerinnen und Schülern möchte ich mitgeben: Die Welt steht euch offen. Lasst euch inspirieren, bleibt neugierig – ihr werdet euren Weg finden!